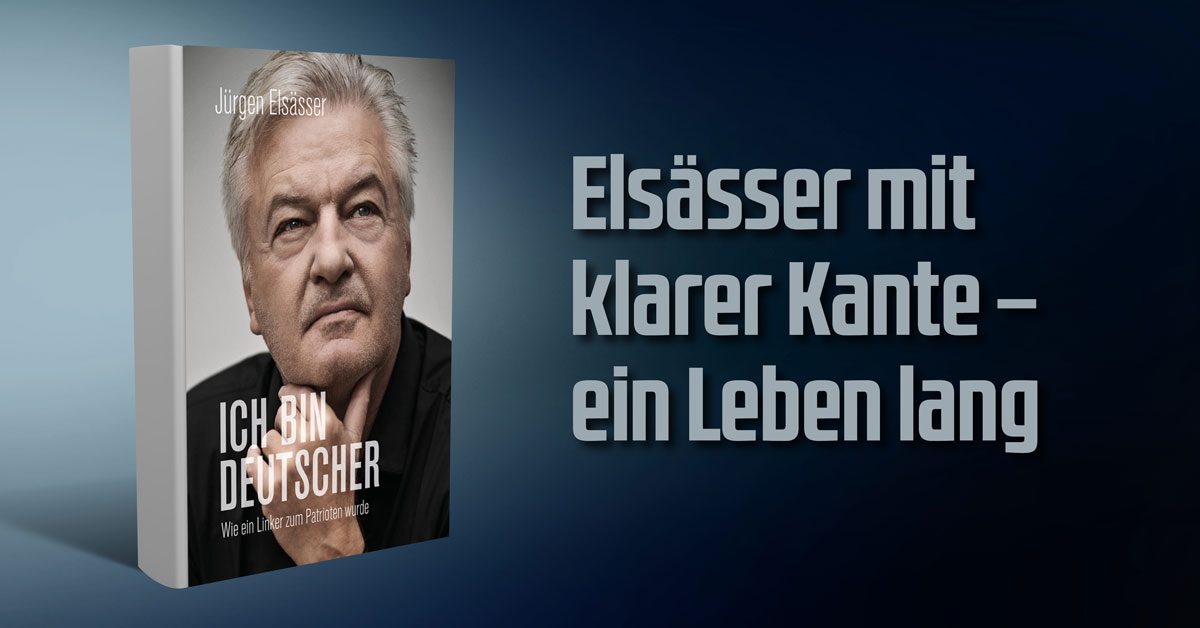Reisebericht aus dem Jahr 2012: Dem Reisenden zeigt sich der Iran als exotische Mischung aus pulsierender Moderne und tiefer Frömmigkeit. Wie geht das zusammen? Und können wir im Westen etwas daraus lernen? Diese Reise und viele andere Ereignisse werden ausführlich in Jürgen Elsässers Autobiografie «Ich bin Deutscher – Wie ein Linker zum Patrioten wurde» geschildert. Hier mehr erfahren.
Ankunft Imam Khomeini-Airport, 19. April, kurz vor Mitternacht: Wir verlassen den Terminal und steigen in unseren Reisebus. Die Fahrt zu unserem Hotel im Norden der iranischen Hauptstadt sollte über eine Stunde dauern. Das lag einerseits an den gewaltigen Abmessungen Teherans, das heute mit zwölf Millionen Einwohnern so groß wie London ist. Andererseits und vor allem an der verstopften Stadtautobahn: Trotz nachtschlafender Stunde gab es nur Stop-and-go, Stoßstange an Stoßstange und das auf einer gut ausgebauten Strecke mit bis zu zehn Fahrspuren in einer Richtung.
Dieser erste Eindruck sollte während unserer zehntägigen Reise immer wieder neu belebt werden: Die Dynamik des Landes, seine Modernität – bis hin zu deren Schattenseiten wie dem drohenden Verkehrsinfarkt. Dabei liegt das Land seit Mitte der 1990er Jahre unter Sanktionen, die, von den USA ausgehend, mittlerweile von allen westlichen Staaten (der selbsternannten «internationalen Gemeinschaft») übernommen wurden und ständig verschärft werden.

Ich kannte ein anderes Land, das unter einer Wirtschaftsblockade litt – Jugoslawien. Mitte und Ende der 1990er Jahre war ich regelmäßig in Belgrad und bekam einen Eindruck von den Auswirkungen: Die Straßen voller Schlaglöcher, die Autos alt und zerbeult, an den Häusern selbst in der Innenstadt bröckelte der Putz, auch in den besten Hotels fiel der Strom aus.
Nichts davon in Teheran. An jeder Ecke, buchstäblich auf Schritt und Tritt, werden Apartmenthäuser hochgezogen, die Straßen sind gepflegt, die Pkw größtenteils neuerer Bauart. Wer vor 20 Jahren den Bauboom im wiedervereinigten Berlin miterlebt hat und im Geiste dessen Tempo verdoppeln würde, könnte sich ein Bild von Teheran 2012 machen.
Die Hoffnung des Westens, man könnte das Land aufgrund seiner fehlenden Raffinerien in der Benzinversorgung austrocknen, hat offensichtlich getrogen. Man sagt uns, seit letztem Jahr sei der Iran autark bei der Spritversorgung. Das können wir nicht nachprüfen, aber wir sehen den nie enden wollenden Verkehr, und wir sehen an den Tankstellen den ausgehängten Literpreis von umgerechnet 30 Cent. In der englischsprachigen Tehran Times ist zu lesen, dass der Ölexport im Februar gestiegen sei – trotz des totalen Kaufboykotts der westlichen Staaten. Was ich damit sagen will: Durch wirtschaftliche Strangulierung wird man dieses Land nicht kleinkriegen. Es hat zu viel eigene Ressourcen, vor allem Öl und Gas.
Besuch im Autowerk
Am nächsten Tag besichtigen wir das Autowerk Saipa. Dort rollen jeden Tag 1.100 Mittelklassewagen vom Band, Stückpreis umgerechnet 3.500 Euro. Kein Wunder, dass ein solches Schnäppchen Abnehmer findet: Die größte Kfz-Fabrik im Nahen Osten exportiert in alle arabischen und zentralasiatischen Länder, in Venezuela und Syrien hat sie eigene Fertigungsstätten. Seit der französische Partner Reetauft im Zuge der Embargoverschärfung ausgestiegen ist, werden alle Teile komplett im Inland produziert. Die 9.000 Kollegen arbeiten im Dreischicht-Betrieb und bringen monatlich 700 bis 1.000 Euro nach Hause.
Das liegt über dem Durchschnittslohn im Iran, und die Miete in der Hauptstadt frisst davon auch noch 200 bis 400 Euro weg. Aber dennoch ist der Lebensstandard für die Masse des Volkes in dem vermeintlichen Schurkenstaat höher als selbst in den osteuropäischen Mitgliedsländern der Europäischen Union: Nirgends sieht man Bettler und Elendsquartiere, die Mehrzahl der Wohnungen in der Hauptstadt wurde den letzten 20 Jahren gebaut. Was vor allem sensationell ist: Im Iran werden in der Industrie und beim Staat nur sechs Stunden pro Tag und 30 Stunden pro Woche gearbeitet.

Statt Samstag und Sonntag, wie bei uns, sind Donnerstag und Freitag frei. Hinzu kommt die Erfüllung einer Forderung, die hierzulande vor allem Grüne und Linke – bis dato vergeblich – erheben: Es gibt ein garantiertes Grundeinkommen, monatlich etwa 50 Euro pro Person. Eine vierköpfige Familie kann so vom Staat 200 Euro extra kassieren. Da es keine bürokratische Kontrolle dieses Anspruches gibt, können die Bürger damit auch ihren Lohn aufstocken. Ein Exil-Iraner in Berlin sagte mir, dass selbst in Deutschland lebende Landsleute mit Hilfe von Konten im Iran an diese Zahlungen gelangten.
Mit diesem Grundeinkommen hat Präsident Mahmud Ahmadinedschad bei den Armen gepunktet. Vorher gab es nämlich Subventionen für Einzelartikel, etwa für Benzin, Heizöl, Kleidung und Nahrungsmittel. Da die Reichen sich davon mehr kaufen konnten, waren auch ihre Zuschüsse höher. Die Umstellung der Stütze auf das Pro-Kopf-System wirkte egalitär und stellte Familien, die kein Auto, aber mehrere Kinder haben, besser als zuvor.
Zu den Schattenseiten der Wirtschaftsentwicklung gehört die traben-de Inflation, die nach inoffiziellen Angaben bei über 20 Prozent liegt. Doch wir wollen uns nicht im ökonomischen Klein-Klein verlieren, sondern gleich ans Eingemachte gehen: Was nützt der ganze wirtschaftliche Fortschritt, wenn er mit Einschränkung von Freiheitsrechten, Folter, Steinigung und Todesstrafe einhergeht? Gab es nicht auch unter Hitler und Stalin beeindruckende Wachstumsraten, und würde dies irgendein vernünftiger Mensch als Pluspunkt bei der Beurteilung dieser Diktatoren, sozusagen als mildernden Umstand, gelten lassen?
Die Schattenseiten des Regimes
Es soll nicht beschönigt werden, dass es diese Menschenrechtsverletzungen im Iran gibt. Die Berichte von Menschenrechtlern sind bedrückend. Und eine Aufrechnerei kann nur im Zynismus enden: Der Schmerz einer Mutter, deren Sohn in einem Gefängnis gefoltert wurde, wird nicht dadurch geringer, dass ihre Tochter eine gut bezahlte 30-Stunden-Woche hat.
Und doch sollte man die Unterschiede zum Nationalsozialismus und Bolschewismus im Auge behalten: Der NS-Staat war ein rassistisches Regime, eines seiner wichtigsten Ziele war die Ausrottung der Juden. Im Iran aber genießen die Juden nicht nur volle Religionfreiheit, sie haben auch ihre eigenen Parlamentsabgeordneten (ebenso wie die Christen und die Zarathustra-Anhänger). Und die Oktoberrevolution war der Putsch einer relativ kleinen Avantgarde und die daraus entstandene «Diktatur des Proletariats» notwendiger Weise die Herrschaftsform einer Minderheit.
Im Unterschied dazu war die Islamische Revolution gegen den Schah im Jahre 1978 ein Aufstand fast des ganzen Volkes. Die Mehrheitsverhältnisse waren so eindeutig, dass die Soldaten des alten Regimes angesichts der demonstrierenden Millionen ihre Gewehre wegwarfen – der Machtwechsel war weitgehend unblutig. Dass sich das in der Folge änderte, hängt auch mit dem Überfall des Irak 1980 zusammen. Während der – vom Westen finanzierten und munitionierten – achtjährigen Aggression Saddam Husseins starben 300.000 Iraner. Trotz der Repressalien gegen – vermeintliche und echte – 5. Kolonnen des Feindes büßte die religiöse Führung des Landes in diesem Abwehrkampf nichts an ihrer Popularität ein.
Wahlen und Gewaltenteilung
Das ist auch der Grund, warum die Islamische Republik bis heute als Demokratie funktionieren kann. Es wird auf allen Ebenen gewählt, ganz anders als in den Golfstaaten und Saudi-Arabien. Und es gibt eine Gewaltenteilung: Ahmadinedschad als Präsident bestimmt die aktuelle Politik, aber im Parlament – auch das haben wir live erlebt – wird scharf gegen ihn geschossen, und der mächtige Wächterrat verhindert, ganz wie unser Verfassungsgericht, Verstöße von Legislative und Exekutive gegen die Grundlagen des Staates. Dass dieser Wächterrat bestimmte Kandidaten bei Präsidentschaftswahlen nicht zulässt, sollten die USA übrigens besser nicht kritisieren: Auch dort gibt es eine solche Vorauswahl, nur nimmt sie nicht die Hohe Geistlichkeit vor, sondern das Große Geld. Wer nicht die Unterstützung des Finanzkapitals hat, wird in God’s Own Country nie zu den Präsidentschaftswahlen antreten können.

Was die Islamische Republik so stabil macht, konnten wir beim zentralen Freitagsgebet in Teheran erleben: Der Prediger, Ajatollah Dschanatti, brach in Tränen aus, als er über das Schicksal der Prophetentochter Fatima sprach — und viele der 100.000 Gläubigen auf dem Riesenareal weinten mit ihm.
Das für uns Westler schwer Verständliche ist, dass diese Erinnerung an Ereignisse vor fast 1.500 Jahren für die Schiiten keine religiöse Folklore ist, sondern aktuelle politische Handlungsanleitung: Sie assoziieren die Kalifen, die sich (unter anderem) durch die Tötung Fatimas den Weg zur Nachfolge Mohammeds freikämpften, mit dem Macht- und Geldprinzip, das heute in den westlichen Staaten ebenso dominiert wie etwa in Saudi-Arabien.
Demgegenüber verträten nur sie, die Partei (Schia) des von Mohammed designierten Nachfolgers Ali, die Reinheit des Glaubens ohne persönliche Bereicherung. Aus dieser Lesart der islamischen Geschichte ergibt sich ein starker sozialrevolutionärer Impuls, der den Iran auf den ersten Blick aussehen lässt wie früher die sozialistischen Staaten.
Überall hängen in Teheran die riesigen Porträts der Revolutionsführer Khomeini und Chamenei, so wie früher in Moskau die Konterfeis von Marx und Lenin. Auch die Slogans auf den Spruchbändern («Für die Unterdrückten auf der Welt!») sind ähnlich.
Dies zeigte sich auch bei unserem Empfang bei Ahmadinedschad. Er sprach mit uns weniger über aktuelle Politik, als über Philosophie und Reli-gion, etwa dass alle Menschen unabhängig von Hautfarbe und Religion Brüder seien und denselben Gott hätten. Ganz besonders appellierte er an uns als Christen: Der jüngste Tag, der Gerechtigkeit auf Erden bringen soll, werde angekündigt durch die gemeinsame Wiederkehr des «verborgenen Imam» in Begleitung von Jesus Christus. So eine Rede hätte ich vom Dalai Lama erwartet, aber nicht von einem Politiker.
Aber genau in dem, was wir beim Freitagsgebet und bei Ahmadinedschad erlebt haben, liegt die Stärke des Iran: Dass der Staat die spirituellen Kraftquellen des Volkes, vor allem die religiösen Werte und Traditionen, als Leitlinie für die Politik (und für das Alltagsleben) erschlossen hat und ständig weiter erschließt. Dabei ist mir klar geworden, dass die Islamische Republik als Vorbild für unsere europäischen Völker nicht geeignet ist, weil deren Religion und Traditionen einfach nicht die unseren sind, und jeder Versuch, diese uns überzustülpen, nur mit Mord und Totschlag enden könnte.
Die Schiiten, übrigens im Unterschied zu Salafisten und Wahhabiten saudischer Provenienz, scheinen das auch verstanden zu haben. Modell kann der Iran aber insofern sein, als dass ein Volk nur dann zu sich selbst finden und einen stabilen Staat aufbauen kann, wenn es die Wurzeln der je eigenen Kultur und des je eigenen Glaubens wiederfindet und pflegt. In diesem Sinne ist es eigentlich ein Segen, dass der gegenwärtige Papst ein Deutscher ist. Wann reist Benedikt XVI. nach Teheran und betet mit Imam Chamenei für den Frieden der Welt?
Mehr über diese Reise und viele andere Ereignisse und Persönlichkeiten, die Jürgen Elsässer im Laufe seines bewegten Lebens getroffen hat, erfahren Sie in seiner Autobiografie «Ich bin Deutscher – Wie ein Linker zum Patrioten wurde» geschildert. 580 Seiten, zahlreiche Fotos, gebunden mit Schutzumschlag und Lesebändchen. Hier bestellen.